Werden geschlechtergetrennte Sportwettbewerbe demnächst ganz verschwinden? Diese Frage drängt sich in Anbetracht der neuesten Richtlinien des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) zum Thema Transgender-Athleten auf. Der neue Dekalog, der nach den Olympischen Spielen 2022 in Peking für alle nationalen Verbände verbindlich werden soll, beginnt mit einer ansprechenden, geradezu pleonastischen Prämisse, gelangt dann jedoch zu eher fragwürdigen Schlussfolgerungen.
Die neuen Richtlinien
„Jeder Mensch“, so heißt es, „hat das Recht, ohne Diskriminierung und unter Wahrung der Gesundheit, der Sicherheit und der persönlichen Würde Sport zu treiben“. Absolut korrekt, sollte man meinen. Und weiter: „Jeder Mensch, unabhängig von seiner Geschlechtsidentität, seinem Geschlecht und seinen möglichen Ausprägungen, hat das Recht, an Sportwettkämpfen teilzunehmen“. Abgesehen von der bedenklichen Unterscheidung zwischen biologischem Geschlecht und Geschlechtsidentität ist in diesem zweiten Absatz ganz allgemein von „möglichen Ausprägungen“ die Rede: als wäre die Biologie ein Accessoire, das man nach Belieben anziehen oder auswechseln kann. Es folgt die Kernaussage der Richtlinien: „Die Athleten und Athletinnen dürfen in der Kategorie antreten, die ihrem erwählten Geschlecht am besten entspricht. Bei keinem Sportler, egal ob männlich, weiblich oder in Transition zwischen den beiden Geschlechtern befindlich, dürfen medizinische Tests zur Überprüfung des Geschlechts durchgeführt werden.“
Verzicht auf Testosteron-Tests
Die größte Neuerung gegenüber den vorherigen Richtlinien von 2016 besteht darin, dass nun weder Testosterontests und noch andere medizinische Untersuchungen zur Bestimmung des Geschlechts erforderlich sind. Obwohl eine in der Fachzeitschrift Sports Medicine veröffentlichte Studie dies bestreitet – wie die britische Zeitung The Guardian berichtet – stellten diese Tests eine Art Hürde dar, die nun auf dem Weg zur gleichmacherischen Gleichgültigkeit der Geschlechter niedergerissen wird. Ein bisschen so, wie es mancherorts in Hinblick auf geschlechtsneutrale „Regenbogentoiletten“ geschieht: Es genügt, sich selbst als Vertreter des anderen biologischen Geschlechts zu deklarieren. Die jeweiligen Nationalverbänden müssen entscheiden, ob ein Athlet, der einen Kategorienwechsel beantragt, einen unverhältnismäßigen Vorteil erhält.
Kritische Stimmen
Kritik an den Richtlinien ließ nicht lange auf sich warten. Die einstige Schwimmerin Sharron Davies aus Großbritannien, Silbermedaillengewinnerin über 400 m bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau, führt derzeit einen Kampf, um rückwirkend die Goldmedaille zu erhalten. Die Britin kam damals hinter der ostdeutschen Schwimmerin Petra Schneider, die später zugab, Dopingmittel eingenommen zu haben, lediglich als Zweite ins Ziel. Davies schlug deutliche Töne an: „Nachdem das IOC zwei Jahrzehnte lang die Situation in der DDR ignoriert und die Athletinnen im Stich gelassen hat, sind wir nun erneut mit einer feigen Art der Verantwortungsverschiebung konfrontiert“.
Der IOC-Berater Joanna Harper, seines Zeichens Arzt und Transgender-Person, ist ebenfalls kritisch. Er räumt ein: „Transgender-Frauen sind im Durchschnitt größer, kräftiger und stärker als Cis-Frauen, was in vielen Sportarten einen Vorteil darstellt“; Cis steht für cisgender und meint biologische Frauen. Harper zufolge „ist es außerdem unangemessen, von Sportverbänden zu verlangen, fachlich fundierte und überprüfbare Studien durchzuführen, bevor sie Beschränkungen für Trans-Athleten im Spitzensport einführen. Eine solche Forschung würde Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern“. Wer weiß, womöglich werden bei diesem Tempo in ein paar Jahren die Kategorien Frauen und Männer im Bereich Sport sogar ganz abgeschafft sein.













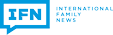






Discussion about this post