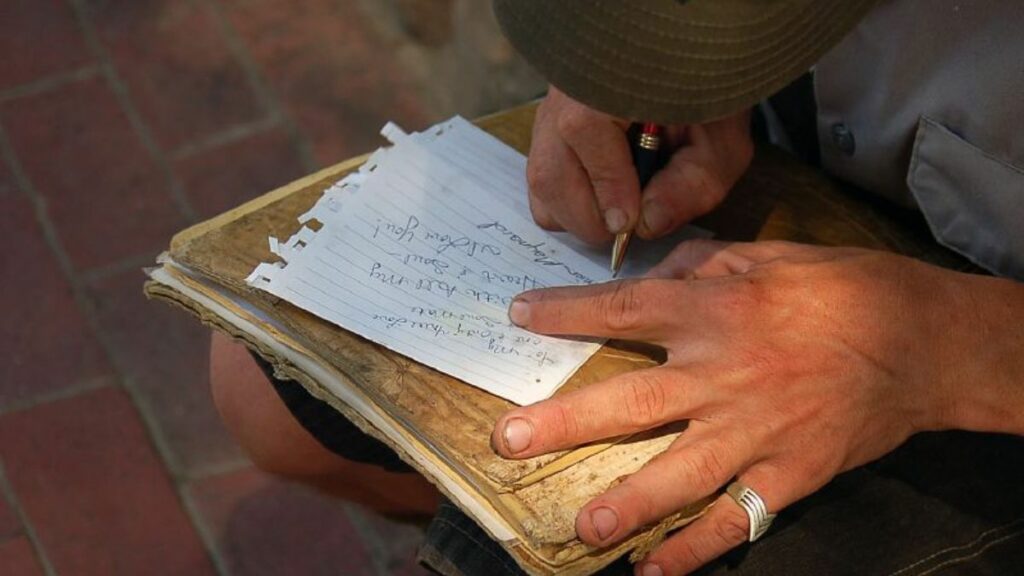Das Referat „Gleichstellung, Inklusion, Vielfalt“ der Generaldirektion für Personal des Europäischen Parlaments hat sich offenbar ein Beispiel an der literarischen Fantasie Henrik Stangerups (1937-1998) genommen, um „ein neues, genehmigtes Wörterbuch vorzubereiten, das kostenlos an jeden Haushalt verteilt wird und in dem alle Wörter in nur zwei Gruppen eingeteilt werden: positive und negative Wörter“. Der dänische Schriftsteller beschrieb in seinem 1973 erschienenen Buch Der Mann, der schuldig sein wollte ein futuristisches Szenario, das sich scheinbar gegenwärtig zu erfüllen scheint oder schon eingetreten ist. Das ist im Wesentlichen der Kern der Nachricht. Der Rest sind nicht wirklich Details, sondern die Ausgestaltung eines auf soziale Kontrolle ausgerichteten politischen Willens, der sich in der Auferlegung dessen manifestiert, was man sagen, schreiben und vielleicht denken darf – oder eben nicht.
Um sich im Begriffsdschungel zurechtzufinden, braucht man ein kleines Handbuch, das einem wie eine Landkarte zeigt, ob man verbotenes oder gar wildes Terrain betritt und wenn ja, wie man wieder den Weg hinaus findet. Zu diesem Zweck wurde in einer langen Entstehungsgeschichte – die eine eingehendere Untersuchung ihrer philologischen Aspekten verdient – und mit Hilfe der Abteilung für Übersetzungen sowie der Kommunikationsabteilung des Europäischen Parlaments ein „Glossar der ‚geschlechtersensiblen’ Sprache für die interne und externe Kommunikation“ veröffentlicht, um den Mitarbeitern zu helfen, sich hinsichtlich Behinderung, LGBT+-Themen sowie ethnischer und religiöser Zugehörigkeit angemessen auszudrücken.
So wird nun beispielsweise empfohlen, wieder „blind“ zu sagen, da „ohne Sehvermögen“ zu sehr nach political correctness klingt und irritieren könnte. Kurzum: „Die goldene Regel, die wir allen Mitarbeitern empfehlen, ist, die betreffende Person zu fragen, wie sie angesprochen werden möchte“. Andernfalls, konsultiere man das Handbuch. Am besten lernt man es sogar auswendig, denn der nächste Fallstrick lauert immer um die Ecke. „Weiß“ ist „kaukasisch“ vorzuziehen, aber man sollte lieber „farbig“ statt „nicht-weiß“ und „asiatisch“ statt „orientalisch“ benutzen, und so weiter.
Wenn jemand „Schwuler“, „Tunte“ oder „Homo“ genannt werden möchte, kann man es ihm nicht verbieten: aber er muss es uns erlauben. Um Missverständnissen vorzubeugen, wird im Kapitel des „Glossars“, das LGBT+ betrifft, darauf hingewiesen, nicht von „biologischem Geschlecht“ zu sprechen, sondern die Umschreibung „bei der Geburt zugewiesenes Geschlecht“ zu verwenden – ganz im Sinne des ideologischen Postulats der Gender-Fluidität, wonach man jederzeit nach Belieben seine Geschlechtsidentität wechseln kann. Da das Vorbild des sich wandelnden Proteus immer wieder neue Form und Gestalt annimmt, ist der Erweiterung des „pathologischen“ Verzeichnisses besondere Aufmerksamkeit zu schenken: Zur klassischen Homophobie kommen „Gayphobie“, „Lesbophobie“, „Biphobie“, „Transphobie“ und „Interphobie“ hinzu. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Einerseits wird die Verwendung von „bisexuell“, „pansexuell“ und „omnisexuell“ sowohl als Substantiv als auch als Adjektiv erlaubt, doch gibt man zu bedenken, dabei auf Stolpersteine zu achten, denn „sie können von denjenigen als beleidigend angesehen werden“, die meinen, dass „die Verwendung solcher Bezeichnungen die betreffende Person ausschließlich auf dieses Merkmal reduziert“. Es folgt eine kuriose Liste von Neologismen, darunter „deadname“: dies bezeichnet den Namen, der einer Transgender-Person bei Geburt gegeben wurde, der aber ausgelöscht werden muss, da er nicht mehr dem Wunsch und der Selbstwahrnehmung der Person entspricht. Wenn er oder sie sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterzieht, ist es nicht zulässig, die Operation als „Geschlechtsumwandlung“ zu bezeichnen, da die angemessene Formulierung „geschlechtsbestätigende Operation“ lautet.
Selbst die „ollen“ Heterosexuellen lässt man nicht in Ruhe, die auch wenn sie sich „normal“ fühlen, nun „zissexuell“ oder „cisgender“ oder „binär“ sind (das hat nichts mit Computern und IT zu tun); sie führen nicht etwa Beziehungen mit Menschen „des anderen Geschlechts“, sondern mit Menschen „des entgegengesetzten Geschlechts“. Man muss diese Menschen, die alles in allem die Mehrheit der EU-Bürger ausmachen, daran hindern, den Keim der sogenannten „Heteronormativität“ zu verbreiten, jene konkrete „Weltanschauung, der zufolge Heterosexualität die Norm ist und heterosexuelle Beziehungen den Maßstab dafür bilden, was normal ist und was nicht“. Vielleicht sollte man unter diesen Umständen besser den Mund halten, um nichts Falsches zu sagen? Nein, Schweigen ist auch nicht erlaubt. Schließlich handelt es sich um Themen, die täglich bei den Versammlungen des EU-Parlaments auf der Tagesordnung stehen, wo die Dolmetscher und Sprecher einer Stresssituation ausgesetzt sind, die mit der von Risikosportlern vergleichbar ist. Denn sollte ein Minister auf einem EU-Gipfel es wagen, das Wort „Vater“ bzw. „Mutter“ zu verwenden, müsste man diesen altmodischen Ausdruck unverzüglich korrigieren und mit der moderneren Formulierung „Elternteil“ wiedergeben. Zwar büßt der Originaltext dadurch an Authentizität ein, doch spielt dies angesichts der sich vollziehenden Spaltung von Wahrheit und Recht nur eine untergeordnete Rolle.